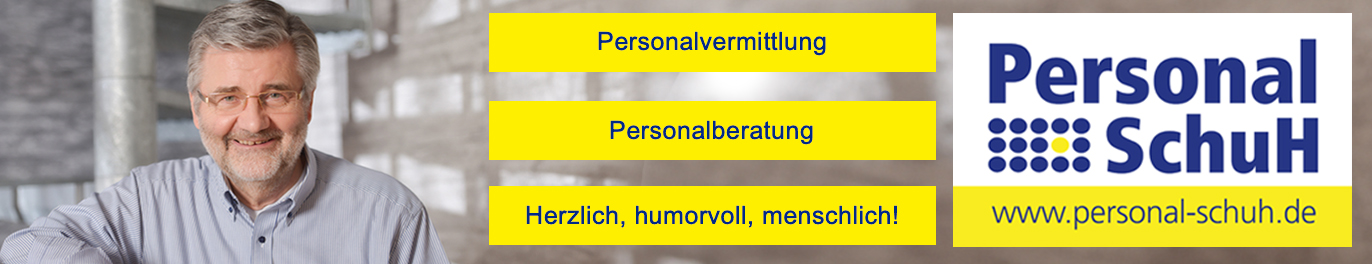Kaltenkirchen (em) Von Schulleiter Egon Boesten: Schwache Schüler werden von den stärkeren unterstützt ist doch toll. Alle bleiben bis zum Schulabschluss in derselben Klasse, oder zumindest in der gleichen Klasse. Ältere Schüler helfen den jüngeren. Nicht mehr der Lehrer gibt vor, sondern die Schüler beschäftigen sich selbstständig mit den kleinen und großen Fragestellungen zwischen Biologie, Geschichte und Physik, ganz offen und hauptsächlich allein, ohne Druck. Die Schule als Paradies.
Gut gemeint und gut gewollt ist aber noch lange nicht gut gemacht. Die integrierte Gesamtschule, von Professor Helmut Fendt aus Dortmund in den Pädagogen-Himmel gehoben, ist gescheitert. Und das nicht wegen der meist unsagbaren unüberschaubaren Größe in NRW gab es Gesamtschulen mit an die 2.000 Schüler. Nein, sagt Fendt in der ZEIT: „Die größte Enttäuschung entsteht beim Blick auf die soziale Selektivität bei den verschiedenen Stufen des Bildungs- und Berufsweges. Sie wird durch Förderstufen oder Gesamtschulen nicht reduziert! Bei ehemaligen Kindern aus Gesamtschulen, Förderstufen und dem dreigliedrigen Bildungswesen bestimmt die soziale Herkunft gleichermaßen mit, welche Schulabschlüsse, Ausbildungen und Berufe sie erreichen.“
Das war im Jahr 2008. Seit dem darauffolgenden Jahr, weiß man noch mehr, warum die hehren Gedanken gut gemeint und gewollt waren, aber nicht umzusetzen sind. John Hattie, neuseeländischer Bildungsforscher nahm 50.000 weltweit durchgeführte Untersuchungen zum Thema Unterrichtserfolg („What works“) und überprüfte, was wirksam ist und räumte mit lieb gewonnenen Vorstellungen auf. Nebenstehend die bedeutsamsten. Nach Hattie kann niemand mehr behaupten, es sei anders es sei denn, er kommt mit 50.001 Untersuchungen, die das Gegenteil belegen.
Schwache Schüler gehen in starken Klassen unter
„Starke Schüler ziehen schwache Schüler nicht automatisch mit im Gegenteil: Wer selbst nicht so gut im Unterricht ist, lässt sich von den guten Noten seiner Klassenkameraden eher verunsichern. Das haben Bildungsforscher Ulrich Trautwein und seine Kollegen von der Universität Tübingen zusammen mit Forschern der University of Houston und der University of Illinois herausgefunden. „Der Effekt habe sich bereits in anderen Studien gezeigt“, sagte Trautwein dem SPIEGEL. „Neu sei allerdings, dass er auch 50 Jahre später noch messbar sei: Wer als Kind auf eine Schule mit sehr leistungsstarken Schülern ging und selbst eher durchschnittliche Noten hatte, verdiente später weniger und arbeitete in weniger angesehenen Berufen als jemand, der auf einer Schule mit schwächeren Schülern war. Kinder, die von besseren Mitschülern umgeben sind, lassen sich schneller entmutigen als Schüler in leistungsschwachen Klassen. Die Folgen sind noch 50 Jahre später spürbar“, so der SPIEGEL in seiner Online-Ausgabe vom 17. Oktober.
Der ständige Vergleich mit besseren Mitschülern setzte einigen Schülern dabei offenbar nachhaltig zu. „Das sind dramatische Erfahrungen, die sich ins Gedächtnis einzubrennen scheinen“, sagte Trautwein. Diese „seelischen Wunden“ in der Kindheit führten dazu, dass junge Menschen ein geringeres Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickelten mit langfristigen Folgen. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift „Psychological Science“ veröffentlicht.
Jahrgangsübergreifender Unterricht funktioniert nicht
In den vergangenen Jahren hat sich in der deutschen Schulöffentlichkeit und in einem Großteil der Grundschulen das jahrgangsübergreifende Lernen durchgesetzt, kurz „JüL“ genannt. Dahinter steht die Idee, dass jüngere Schüler von älteren lernen, schwächere von fixeren mitgezogen werden. Jeder solle in seinem Lerntempo arbeiten, am besten in Gruppen ohne Frontalunterricht. Lehrer sollten in Teams unterrichten und dadurch entlastet werden. Im Gegenteil: So berichtet Gisela Steins von der Universität Duisburg-Essen über die „Evaluation eines Schulversuchs zum jahrgangsübergreifenden Unterricht der Albert-Schweitzer- Grundschule in Essen“ am Ende: „Aufgrund der Ergebnisse, die hier zusammengetragen wurden, ist dieses Modell zwar kostenneutral (in Einheiten von Unterrichtsstunden gerechnet), aber es trifft nicht die intellektuellen und sozialen Bedürfnisse der Kinder.“ „Dass Schüler ihre ,Lernprozesse am besten selbst gestalten, wie etwa die jüngst gegründete Initiative ,Schule im Aufbruch propagiert, dürfte Hattie für abwegig halten. Andere Lieblingskonzepte der Neudenker von Schule fallen bei ihm ebenso durch. Das gilt besonders für den ,offenen Unterricht oder die ,jahrgangsübergreifenden Klassen. Für beides hat Hattie so gut wie keine empirischen Belege dafür gefunden, dass es das Lernen verbessert.“
Selbstregulierter oder offener Unterricht bringt keinen Lerngewinn
Leider kann man den Heranwachsenden nicht einfach sagen: Nun mache es selbst. Das selbstständige Lernen ist voraussetzungsreich und muss in der Schule angebahnt werden. Die Befähigung zur Selbsttätigkeit versteht sich als ein mühsamer Weg von der reinen Instruktion zur reinen Selbsttätigkeit. Offener Unterricht ist gut gemeint funktioniert aber nicht. Für Deutschland hat die Forschungsgruppe um Andreas Helmke herausgefunden: „Mit den richtigen Werkzeugen urteilen Schüler meist fair und überraschend präzise über Unterricht“, sagt der Schulforscher von der Universität Koblenz-Landau. Auch können Schüler gut ermessen, was sie selbst können. Kein anderes Instrument kann in Hatties Ranking eine größere Effektstärke aufweisen als die systematische Selbsteinschätzung von Schülern.
Hattie predigt eine Kultur des „Feedback“, kein Begriff fällt häufiger in seinem Buch. Von Lob dagegen spricht er wenig, von Strafe überhaupt nicht. Laut Hattie sollen Rückmeldungen an Schüler stets neutral erfolgen, bezogen allein auf den Unterrichtsgegenstand. Falsche Antworten der Schüler sind in diesem Konzept geradezu willkommen. Hattie versteht Fehler als die eigentlichen Treiber allen Lernens („the essence of learning“).
Finanzielle Ausstattung von Klassen und Schulen haben keinen Einfluss
So hat die finanzielle Ausstattung einer Schule nur wenig Einfluss auf den Wissensgewinn ihrer Schüler. Ähnlich verhält es sich mit der Reduzierung der Klassengröße, der Lieblingslösung der Lehrerschaft für Probleme jeder Art. Kleine Klassen kosten zwar viel Geld, bleiben in puncto Lernerfolg aber weitgehend ertraglos. Kleinere Klassen haben nach einer neuen Studie weniger Einfluss auf die Leistung der Schüler als bisher angenommen. Diesen Schluss ziehen Wissenschaftler aus der Analyse von Daten, die für die letzte Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) erhoben wurden, berichtet der SPIEGEL. „Ein Einfluss der Klassengröße ist nicht nachweisbar“, stellten die Forscher nach der Auswertung des statistischen Materials fest.
Frontalunterricht ist von gestern stimmt nicht
Obwohl er immer noch an den meisten deutschen Schulen Standard ist, gilt der Frontalunterricht schon seit Langem als Auslaufmodell. Neuere Studien allerdings attestieren dieser Unterrichtsform gute Erfolge, deutlich mehr Erfolge als der sogenannte problemorientierte Unterricht. Schüler lernen dann am besten, konstatiert die Studie, wenn Lehrer ihre Klasse stringent führen, stets im Griff haben und ihren Unterricht klar strukturieren. „Wenn ein Lehrer zehn Prozent mehr Zeit auf frontales Unterrichten verwendet“, sagt Schwerdt, „dann zeigen Schüler einen Leistungsvorsprung, der ungefähr dem Wissenszuwachs von ein bis zwei Monaten Schulbildung entspricht.“ Nicht nur die leistungsstarken, auch die schwächeren Schüler würden davon profitieren, so die Untersuchung.“
Auf einen Blick: Diese Aspekte widersprechen den Wunschvorstellungen
Schwache Schuler gehen in starken Klassen unter
Jahrgangsubergreifender Unterricht funktioniert nicht
Selbstregulierter oder Offender Unterricht bringt keinen Lerngewinn
Finanzielle Ausstattung von Klassen und Schulen haben keinen Einfluss
Stimmt nicht: Fontralunterricht ist von gestern