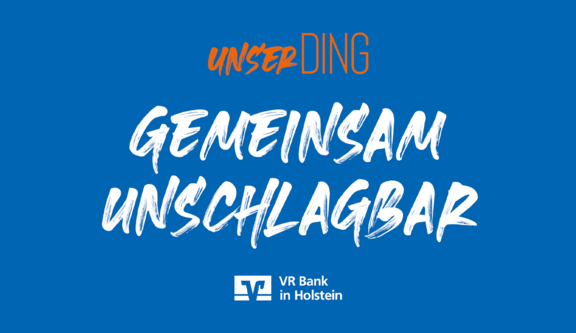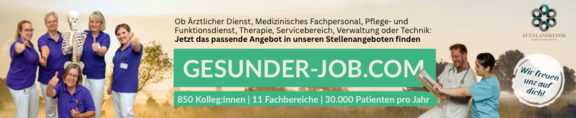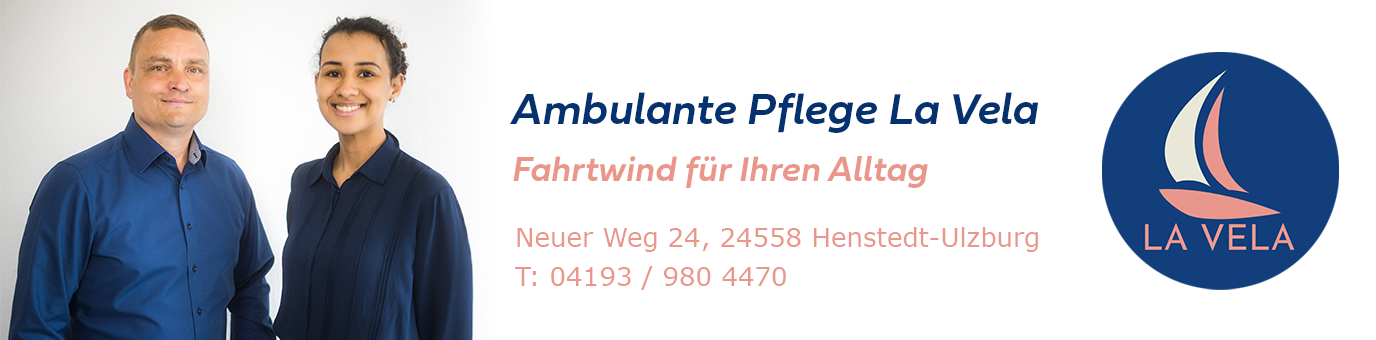Neumünster (em) Am Sonntag, 19. Juni, um 14 Uhr wird die Austellung „Problemspiel“ von Carsten Höller in der Gerisch-Stiftung, Brachenfelder Str. 69, Neumünster, eröffnet. Insgesamt kann die Ausstellung vom 19. Juni bis zum 23. Oktober besichtigt werden.
Ob durch ein Haus für Menschen und Schweine auf der documenta X, gigantische Rutschen in der Tate Modern, London oder lebende Rentiere im Hamburger Bahnhof der Nationalgalerie Berlin, der Künstler evoziert mit seinen auf die jeweiligen Orte reagierenden Raumarbeiten unmittelbare emotionale Reaktionen, die zunächst ganz unabhängig vom Kunstsystem funktionierendnicht selten durch Konditionierungen aus Kindheitstagen ausgelöst werden.
So auch in der Gerisch-Stiftung: Ein Kinderkarussell auf der Waldwiese vor der Villa Wachholtz, daneben ein großer Fliegenpilz, ein totes quietschgrünes Rentierbaby im Eingangsbereich, ein Kabinett voller Vitrinen mit Pilzmodellen, Fotos von Freizeitparks und eine große Box mit einem Labyrinth für Mäuse; In einem Film zeigt der Künstler, wie er als Eigenversuch ausgesuchte Fliegenpilze verzehrt und dokumentiert deren Wirkung: zwischen halluzinatorischer Erleuchtung und Übelkeit.
All dies: Erlebnispark, wissenschaftliches Experimentierlabor oder Ausstellung? Die Situationen und Bilder, die Carsten Höller schafft, entziehen sich jeder eindeutigen Zuschreibung. So ist es formal gesehen ein weiter Bogen, den der Künstler mit seiner Inszenierung in der Gerisch-Stiftung spannt.
Er nennt sie „Problemspiel“. Ein Spiel mit Problemen? Es scheinen die großen problembehafteten Glücksversprechen unserer Zeit zu sein, die sich als roter Faden durch die Ausstellung ziehen. Sehnsucht, Rausch, Glück, Mythos und Liebe werden als gesellschaftliche Konstrukte entlarvt, indem sie Betrachtungsweisen unterzogen werden, die wir mit wissenschaftlichen Experimenten und Dokumentationen in Verbindung bringen. Aber immer geht es Höller dabei auch um Erkundungen des eigenen Bewusstseins. Tiere bzw. die Rollen, die wir ihnen zuweisen, haben dabei eine wichtige Bedeutung.
So z. B. in der Arbeit der Ausstellung Loverfinch (Liebesfink): Der Filmdokumentation liegt eine Liebesgeschichte aus dem 18. Jahrhundert zugrunde. Ein Baron, lebend im Schloß Rosenau nahe Coburg, verliebte sich unsterblich in ein Mädchen aus dem nahegelegenen Dorf. Da sie ihn nicht erhören wollte, musste er sich etwas einfallen lassen. Er ließ alle frisch geschlüpften Dompfaffen aus ihren Nestern nehmen, zu sich bringen und lehrte sie jenes Liebeslied zu pfeifen, dass er allabendlich unter dem Fenster der Auserwählten zu singen pflegte. Nachdem er die jungen Vögel wieder in seinem Park ausgesetzt hatte, lud er seine Angebetete auf einen Spaziergang ein. Als sie bemerkte, dass hunderte Dompfaffe das Lied des Barons von den Bäumen trällerten, erhörte sie ihn endlich. Selbst heute noch nach mehr als 250 Jahren, kann man auf dem Anwesen Rosenau die Dompfaffen Passagen dieses Liedes singen hören, denn die Vögel brachten es ihrem Nachwuchs bei, diese dem ihren und so weiter. Der Film Loverfinch zeigt letztendlich „nur“ Bilder eines Experiments, bei dem ein Dompfaff trainiert wird, diese Melodie nachzupfeifen. Bevor dies endgültig gelingt, endet die Dokumentation, das Happy-End bleibt aus, die Hoffnung auf das Gelingen des Zusammenspiels von wissenschaftlich fundierter Strategie und beseeltem Gefühl jedoch bestehen. Problemspiel schließt den Bogen auch zu den frühen Arbeiten des Künstlers, die er noch in seiner Kieler Zeit (bis 1991) geschaffen hat.
Hierbei geht es durchaus auch zynisch und grausam zu. So werden in dem in der Villa Wachholtz eingerichteten rosaroten Balkonzimmer aus harmlosen Kinderzimmerrequisiten bösartige Kinderfallen. Das Benutzen seiner Schaukel auf dem angrenzenden Balkon wäre, ähnlich dem Verzehr von Fliegenpilzen, lebensgefährlich. Bildlich führen uns diese Arbeiten an unsere existenziellen Grenzen, an die dunklen, immer in die Idylle eingeschriebenen Kehrseiten menschlichen Daseins: grenzgängerisch riskant oder bewusstseinserweiternd, wie z. B. das Muscimol, Inhaltsstoff des sagenumwobenen und vermutlich aus Fliegenpilzen gewonnenen Tranks „Soma“, dem in der Ausstellung eine eigene Arbeit gewidmet ist.
Eine solche Entrückung der alltäglichen Wahrnehmung zeigen auch die großformatigen Fotoserien des Künstlers, z. B. die Serie der jüngst fertiggestellten Karussell-Fotos in der Gerisch-Galerie: Verschwommen, verzerrt, künstlich koloriert geisterhafte Bilder, wie Halluzinationen. Die Menschen in den abgebildeten Freizeitparks erscheinen darin als fremd bestimmte Versuchskaninchen; ganz wie die Mäuse im Mäuseplatz, ein verkleinerter Nachbau eines Pariser Spielplatzes, bei dem nun das Verhalten der kleinen Nager beim Durchqueren von ursprünglich für Kinder geschaffenen Röhren, Labyrinthen und Hindernissen studiert werden kann. Einem Rundumblick auf Höllers Gesamtwerk gleich bringt Problemspiel Bereiche des menschlichen Lebens zusammen, die sonst nicht weiter auseinander liegen könnten: Kindheit, Spiel, Unschuld versus Grausamkeit, Quälerei, Tod.
Die besondere Biografie des Künstlers scheint durchaus prägend für seine künstlerische Vorgehensweise, die sich wie eine eigene Handschrift immer leicht erkennen lässt. 1961 in Brüssel geboren, studierte Höller Biologie, promovierte und spezialisierte sich in seiner agrarwissenschaftlichen Habilitation auf Parasitologie. Die gesellschaftlich geforderte und üblich strikte Trennung von Kunst und Wissenschaft mag dazu beigetragen haben, dass Höller die „Seiten“ wechselte und die gleichen experimentell ausgerichteten Fragen nun mit den Mitteln der Kunst stellt.
Eine seiner Arbeiten wird zudem in Neumünster bleiben: Ein monumentaler 3,5 Meter großer Giant-Triple-Mushroom (zusammengesetzt aus einem halben Fliegenpilz sowie je einem Viertel Speisemorchel und Violetter Rötelritterling) wird als jüngste Errungenschaft des Sammlungsbestands der Gerisch-Stiftung im sogenannten „Märchenwald“ (Harry Maasz, 1924) des Gerisch-Skulpturenparks fest installiert.
Kurator der Ausstellung:
Dr. Martin Henatsch, Künstlerischer Leiter der Gerisch-Stiftung
Öffentliches Gespräch mit dem Künstler:
Sonntag, 25. September, 12 Uhr, Villa Wachhholtz