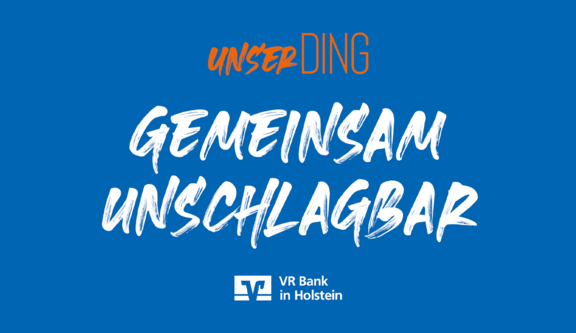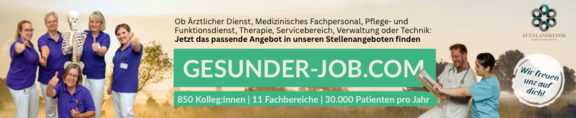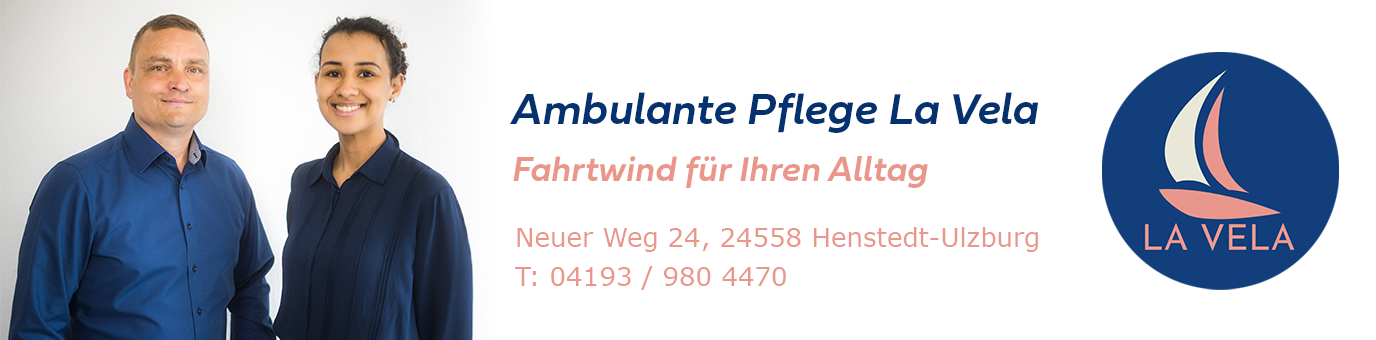Norderstedt (em) Norderstedts Sozialdezernentin Anette Reinders erklärt die Grundsätze der sozialraumorientierten Jugendarbeit.
Frau Reinders: Zum Jahreswechsel ist die Jugendhilfe in der Stadt Norderstedt auf sozialräumliche Strukturen umgestellt worden. Wie lässt sich der Grundgedanke der sogenannten Sozialraumorientierung kurz und griffig beschreiben?
Anette Reinders: Man könnte sagen: Ein Stück Dorf, in dem die Menschen starke soziale Bindungen zueinander haben, wird in die Stadt geholt. Wir betrachten dabei verstärkt die Umgebung, also den Sozial-Raum, in dem die jungen Leute leben. Was gibt es für Angebote im jeweiligen Stadtteil, im jeweiligen Quartier? Und was fehlt dort? Wir arbeiten heraus, was die Menschen brauchen, um in ihrem Viertel, ihrem Quartier gut leben zu können.
Also löst man sich in Zukunft vom Einzelfall?
Anette Reinders: Auch bei der Sozialraumorientierung steht der Einzelne im Mittelpunkt der Hilfen, der Blickwinkel wird aber erweitert. Neben professionellen Möglichkeiten werden auch die Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten in der familiären und sozialen Umgebung miteinbezogen. Diese Ressourcen wollen wir nutzen und fördern. Es geht also sehr viel um Hilfe zur Selbsthilfe. Wir möchten die Bewohner der Sozial-Räume dazu bringen, Eigeninitiative zu entwickeln und Verantwortung für ihr Quartier und seine Menschen zu übernehmen. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das lautet: Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.
Aber auch die individuellen Ressourcen, in diesem Falle der jungen Menschen, sollen gehoben und gefördert werden?
Anette Reinders: Richtig, Ausgangspunkt der Arbeit ist stets der Wille des oder der Menschen. Statt vielleicht zu bevormunden, wird gemeinsam nach der besten Lösung gesucht. Dazu gehört es unter anderem, zu akzeptieren, dass bestimmte Menschen auch ganz bestimmte Bedürfnisse und Lebensweisen haben, die eventuell von denen vieler anderer abweichen. Es gilt möglichst alle Menschen mitzunehmen auf diesem neuen Weg. Dazu gehört auch ein Umgang auf Augenhöhe.
Heranwachsende, die staatliche Hilfe bekommen, werden leider auch oft stigmatisiert, oder?
Anette Reinders: Es wird zu leicht vergessen, dass Kinder und Jugendliche, die auf einigen Gebieten Probleme haben, auf anderen Feldern ihre Stärken besitzen. Eine der größten Herausforderungen der Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche so zu stärken, dass sie ihren eigenen Weg in das (Erwachsenen-)Leben gehen können.
Wen holen Sie im Sinne der Sozialraumorientierung ins Boot?
Anette Reinders: Dort, wo familiäre Strukturen nicht oder nicht ausreichend greifen, kommen die Netzwerke im sozialen Umfeld, also im Sozialraum, ins Spiel. Das kann zum Beispiel damit losgehen, dass alleinerziehende Mütter in einem Wohnumfeld eine Kinderbetreuung organisieren. Es gibt in Norderstedt viele gute Beispiele, wo diese Netzwerke funktionieren.
Einen ganz wichtigen Part haben natürlich die freien Jugendhilfeträger, mit denen das Jugendamt der Stadt im jeweiligen Sozialraum und im sogenannten Sozialraumteam eng zusammenarbeitet. Es ist uns bereits fast überall gelungen, gemeinsame Ideen und Vorschläge zu entwickeln. Ein erster Erfolg ist der Bau des Kinder- und Jugendhauses in Friedrichsgabe. Kinder und Jugendliche, die nicht in ihrer Familie bleiben können, sollen dort zukünftig wohnortnah untergebracht werden, können also weiter in ihre gewohnte Schule gehen, sich mit ihren Freunden treffen und Kontakt zu ihren Familien halten.
Was ändert sich konkret für die Mitarbeiter des Jugendamtes der Stadt Norderstedt?
Anette Reinders: Wir haben Norderstedt in zwei Regionen geteilt, die Region Nord und die Region Süd. Die „Grenze“ verläuft etwa auf der Höhe Buchenweg. Jede Region hat zwei Sozialräume. Und in jedem Sozialraum arbeitet ein kollegiales Team aus unterschiedlichen Fachleuten und von verschiedenen Trägern zusammen. Da gibt es Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen aus dem Jugendamt, von freien Trägern, Verwaltungsmitarbeiter/innen und Kolleginnen und Kollegen aus der Jugendarbeit. In Einzelfällen werden weitere Experten an den Tisch geholt, um den Blick zu weiten und neue Lösungen abseits der bisherigen Jugendhilfepfade zu entwickeln.
Jede Region erhält übrigens ein Budget, mit dem die Hilfen finanziert werden. Dieses Budget ist auch Anreiz für alle, möglichst wohnortnahe Lösungen für die einzelnen Hilfefälle zu finden. Dann bleibt das Geld im Quartier, und im optimalen Fall ist die Lösung auch noch günstiger, so dass die ersparten Mittel dann für andere Projekte im Stadtteil eingesetzt werden können.
Wenn Ehrenamtliche stärker eingebunden werden kann dann nicht der Verdacht aufkommen, die Verwaltung entledige sich ihrer Aufgaben?
Anette Reinders: Die Ehrenamtlichen sollen nicht aus vordergründig finanziellen Gründen Aufgaben übernehmen. Es geht vielmehr vor allem um Motivation und Aktivierung von Eigeninitiative innerhalb des Sozialraums. Natürlich bleiben bestimmte Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei den Fachleuten wir sprechen von einem Bürger-Profi-Mix. Wobei professionelle Hilfen oft zeitlich begrenzt sind, während sich aus ehrenamtlichen Kontakten auch lang andauernde Verbindungen bis hin zu Freundschaften entwickeln können.