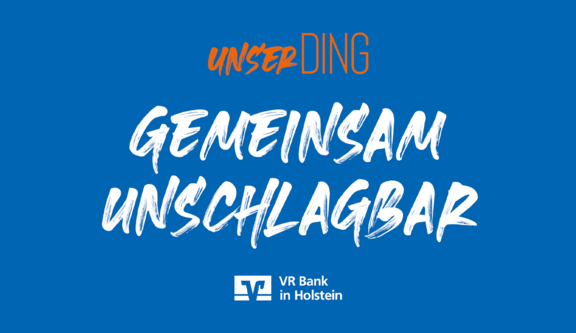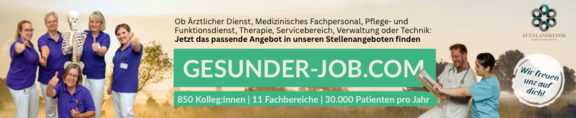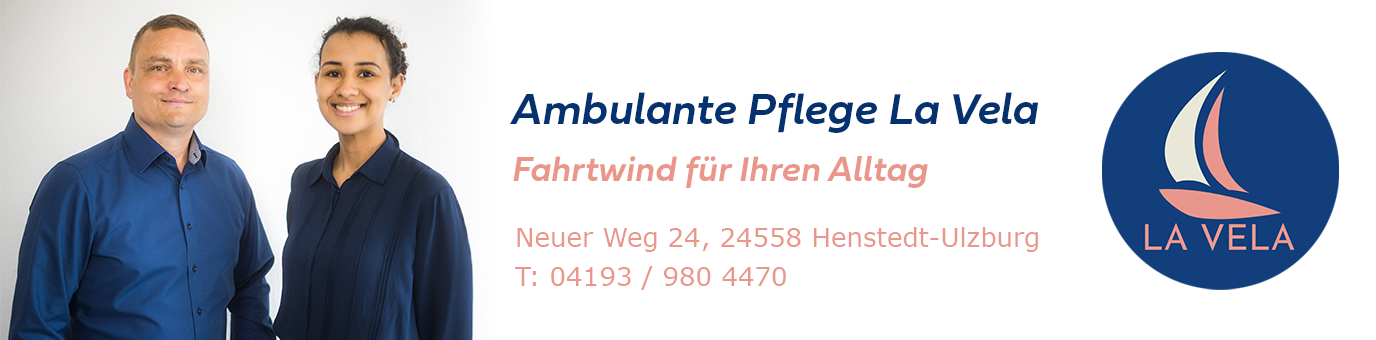Quickborn (em) „Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.“ George Santayana (1863-1952) Am 4. November haben Schülerinneren und Schüler des 12. Jahrgangs des Elsenseegymnasiums gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus dem Kreis Pinneberg einen Ausflug zu der Gedenkstätte Bergen-Belsen und drei Kriegsgräberfriedhöfen gemacht.
Unterstützt wurde diese Fahrt erneut vom Volksbund für Deutsche Kriegsgräberfürsorge und der Volkshochschule Quickborn. Die diesjährige Gruppenzusammensetzung zeigte, dass eine generationsübergreifende Fahrt und der damit einhergehende Austausch für alle Beteiligten interessant war. Insbesondere die Teilnehmer der VHS zeigten sich beeindruckt, wie im heutigen Geschichtsunterricht, das Thema aufgearbeitet wird. Andererseits zeigten die hohe Zahl an Teilnehmern und die Gespräche während der Fahrt, dass es zahlreiche Gründe gibt, sich dieser traditionellen Fahrt anzuschließen.
„Nach circa zweieinhalb Stunden Fahrt sind wir an dem ersten Friedhof angekommen, dem Becklingen War Cemetry. Der erste Eindruck wurde vor allem durch die auf den ersten Blick praktisch identisch aussehenden Grabsteine geprägt, durch die die Anzahl der Gräber noch einmal größer erschien. Ein großer Teil der Opfer stammt aus den letzten zwei Monaten vor Kriegsende, darunter vor allem Briten, Kanadier und Australier. In den Grabsteinen sind die Einheit, die Namen und Lebensdaten, der Dienstgrad und soweit erwünscht auch eine Widmung der Angehörigen eingraviert. Erschütternd für uns waren nicht nur die oftmals sehr jungen Opfer der jüngste Gefallene war gerade einmal 15 Jahre alt sondern auch die zahlreichen Gräber unbekannter Gefallener. Nach einer Kranzniederlegung durch einen unserer Lehrer fuhren wir weiter zur Gedenkstätte Bergen Belsen“, berichten die Schüler. Schon an dieser Stelle war die Stimmung der Gruppe bedrückt, was durch die schiere Masse der Gräber und auch die erschreckend jungen Gefallenen verstärkt wurde. „An der Gedenkstätte Bergen-Belsen angekommen, wurden wir durch eine Museumspädagogin detailliert über die Gedenkstätte informiert. Auch wenn das Thema Nationalsozialismus schon mehrfach im Unterricht behandelt wurde, ist es etwas komplett anderes, sich vorzustellen, dass diese grausamen Verbrechen an genau diesem Ort begangen wurden.“
Auch die Geschichte der Gedenkstätte ermöglicht einen Einblick in den gesellschaftlichen Umgang mit Erinnerung. Bergen-Belsen war die erste von rund 100 Gedenkstätten, die bis heute in Deutschland geführt werden. Anfangs bestand sie nur aus einer Gedenktafel, die vor allem von Überlebenden und Angehörigen der Opfer besucht wurde, später als immer mehr Besucher aus der ganzen Welt ihr Interesse bekundeten, begann man, diese Gedenkstätte weiter auszubauen. Zahlreiche Fotos und Filme, die die Briten nach der Befreiung des Lagers gemacht hatten, wurden gesammelt, ebenso wie erhaltene Dokumente aus dem Lager und Augenzeugenberichten der Opfer und Betroffenen. So sind 430 Videos von Interviews mit ehemaligen Häftlingen entstanden, die heute im Dokumentationszentrum zu sehen sind. Das Gefangenenlager, das im März 1933 gebaut wurde, war erst nur für politische Gegner der Nationalsozialisten und sogenannte „Andersartige“ (wie zum Beispiel homosexuelle und geistig behinderte Menschen) als Umerziehungslager geplant.
Ab 1940 wurden die ersten Kriegsgefangenen französische und belgische Soldaten in die Lüneburger Heide gebracht. Ein Jahr später kamen sowjetische Kriegsgefangene hinzu, die ohne Behausungen und regelmäßige Mahlzeiten überleben mussten. Um sich im Winter 1941 vor Schnee, Kälte und Wind zu schützen, blieb den Gefangenen nichts anderes übrig, als sich in selbst gegrabenen Erdlöchern zu verstecken. Von den anfangs 21.000 Gefangenen starben in den Wintermonaten des Jahres etwa 14.000. 1943 errichtete die SS auf dem Gelände zusätzlich ein Konzentrationslager, in dem sämtliche politischen und ideologischen Gegner untergebracht und zur Zwangsarbeit getrieben wurden. Auf dem Weg in dieses Lager starben allerdings schon ein Drittel der Gefangenen. Grausamerweise wurde mit der Gefangenschaft auch noch Profit geschlagen. So konnten jüdische Familien für viel Lösegeld freigekauft werden und die SS verkaufte Knochen, Asche und Zähne der Opfer. Ende 1944 kamen 8.000 junge Frauen aus Auschwitz, darunter Margot und Anne Frank. Für diese Frauen gab es allerdings kaum noch genügend Platz, sodass sie in Zelten ohne Boden und Baracken ohne Licht und Wasser untergebracht wurden. Die Situation verschlimmerte sich noch weiter, als durch eine amerikanische Bombe die Wasserpumpen zerstört wurden und für 2.000 Gefangene nur ein Wasserhahn zur Verfügung stand.
Durch all diese Umstände muss sich den Engländern bei der Befreiung des Lagers am 15. April ein furchtbarer Anblick geboten haben: tausende Leichen lagen auf dem Gelände, so abgemagert das sie mit Menschen kaum noch Ähnlichkeit hatten. Einige Engländer beschrieben den Geruch der ihnen schon Kilometer vom Lager entfernt entgegenkam als so wiederwertig, dass sie sich lieber mit Benzin getränkte Taschentücher vor Mund und Nase hielten. Das verbliebene Wachpersonal der SS, das versucht hatte, vor der Ankunft der Engländer möglichst viele Dokumente zu vernichten, wurde von den Befreiern des Lagers dazu gezwungen, die Leichen in Massengräbern zu begraben. Insgesamt wird heute von mindestens 50.000 Leichen in 14 Massengräbern ausgegangen. Erneut macht es einen Unterschied nur von diesen Gräbern zu hören und sie selber zu sehen.
Auch wenn man heute kaum noch etwas von dem Lager erkennen kann, war jeder unserer Gruppe erschrocken und berührt von dem Anblick. Auf dem Gelände des ehemaligen Lagergeländes befinden sich nicht nur die Massengräber, sondern auch eine Inschriftenwand zu Gedenken aller Opfer des Nationalsozialismus. Außerdem gibt es auch mehrere von Angehörigen der Opfer dort platzierten Grabsteine, die in diesem Fall allerdings keine Gräber markieren, sondern nur dem Gedenken an die Personen dienen sollen. So gibt es auch einen Grabstein zu Ehren Anne und Margot Franks.
Im Haus der Stille zeigen sich die vielen verschiedenen Arten zu gedenken, so legen Juden zum Beispiel Steine anstelle von Blumen auf die Gräber. Viele Besucher drücken ihre Gedanken in Briefen aus, die sie niederlegen. „Anschließend wurde uns eine Stunde Zeit gegeben, das Dokumentationszentrum zu besuchen“, so die Teilnehmer weiter. Hier wird dem Besucher die Möglichkeit gegeben, sich Zeitzeugenberichte (auch von Anwohnern der umliegenden Dorfschaften) und Filmmaterial der Briten anzuschauen. Einer dieser Filmausschnitte war besonders schockierend, da er zeigte, wie die Leichen der Lagerbewohner mithilfe eines Bulldozers in die Massengräber geschoben wurden. „Dieser Umgang mit Menschen scheint uns heute vollkommen unmenschlich und geradezu pervers zu sein, was nur wiederum klar macht, wie grausam die Verbrechen dieser Zeit wirklich waren und wie gut es uns heute geht.“
Immer noch schockiert und betroffen ging die Fahrt nach kurzer Mittagspause weiter zu dem sowjetischen Kriegsgefangenenfriedhof, auf dem zwischen August 1941 und Januar 1945 mindestens 19.580 Tote begraben wurden, anfangs noch in Einzelgräbern, später allerdings aufgrund der großen Zahl an Opfern in Massengräbern. Am Ehrenmal legte unsere Gruppe erneut einen Kranz in Gedenken an die Opfer nieder. Auch hier haben Angehörige die Möglichkeit, Gedenksteine aufzustellen. Der letzte Friedhof den wir besuchten, war der deutsche Soldatenfriedhof. Auf diesem sind vor allem Soldaten begraben, die im Lazarett in Bergen gestorben sind oder 1944/45 in den Kämpfen in Celle und Soltau fielen. An dem dort platzierten Mahnmal wurde der letzte Kranz niedergelegt. Während die Rückfahrt eher still war, wurde vor allem in der darauffolgenden Geschichtsstunde deutlich, dass diese Exkursion jeden auf eine andere Art nachdenklich gemacht und berührt hatte.
Text und Foto: Greta Heinrich, Milena Wiethaup, Luise Andres (alle 12b des ESG) alle Bilder sind aufgenommen worden von Luise Andres