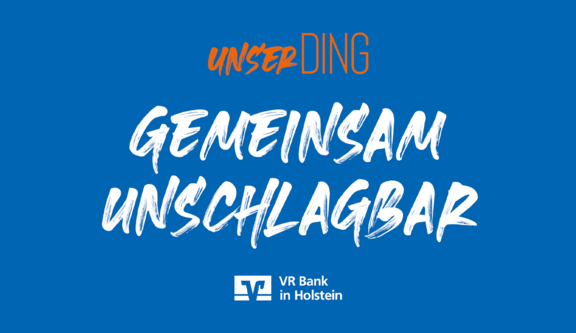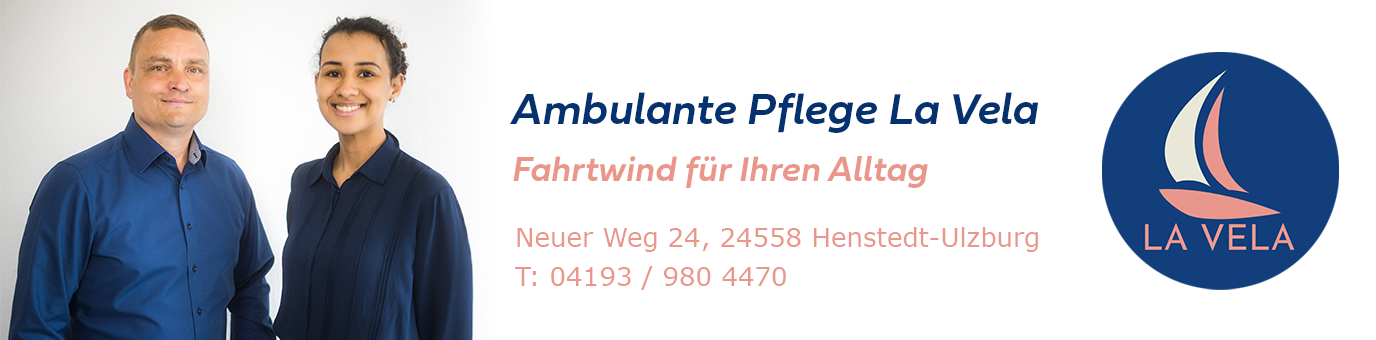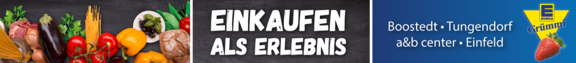Henstedt-Ulzburg (em) Am Mittwoch, 4. Februar ist Weltkrebstag. Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 500.000 Menschen neu an Krebs, etwa 221.000 sterben daran.
Im Jahr 2014 wurden in der Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg 414 Patienten mit Krebs behandelt, 198 davon waren Brustkrebspatientinnen. Susanne Warnck ist seit 2010 für die Paracelsus-Klinik tätig. Die Diplom-Psychologin hat die Zusatzausbil-dung zur Psycho-Onkologin: Sie kümmert sich um die Krebs-Patienten in der Klinik. Auch wenn die 49-Jährige Teil des zertifizierten Brustzentrums der Klinik ist, profitie-ren alle anderen Krebspatienten, die stationär behandelt werden, ebenfalls von ih-rem Therapieangebot. In einem Interview spricht sie über ihre Arbeit, die Ängste der Patienten und ihren Hilfsangeboten. Frau Warnck, wie erfahren die Patienten der Klinik von Ihnen; wie nehmen Sie Kontakt auf?
Ich besuche die Brustkrebspatientinnen auf Station, meistens nach der OP, und stel-le mich ihnen vor. Sie entscheiden dann, ob sie meine Hilfe brauchen oder nicht. Manchmal finde ich auch Nachrichten in meinem Fach vom Pflegepersonal, die mich auf einen bestimmten Patienten aufmerksam machen, der eventuell psychologische Betreuung benötigen könnte. Ich nehme jede Woche an der Chef-Visite auf der gy-näkologischen Station teil und bin auch bei den Tumorkonferenzen dabei. Bei letzteren erfahre ich auch von den anderen Krebspatienten.
Wie viele Patienten behandeln Sie durchschnittlich und wie lange?
Das ist sehr unterschiedlich, nicht kontinuierlich. Gerade bei den Brustkrebserkran-kungen habe ich das Gefühl, dass sie wellenartig kommen. Von den Brustkrebspati-entinnen nutzen mich etwa 35 Prozent für ein weiteres Gespräch, manchmal auch für zwei bis drei Gespräche. Einige Frauen begleite ich auch wesentlich länger, zum Beispiel über die Zeit der Chemotherapie. Wir haben ja den Vorteil, dass wir die Chemotherapie ambulant in der Klinik durchführen können. Im Schnitt kann man sa-gen, dass ich sechs bis acht Patienten hier ambulant in der Woche behandle.
Wo genau findet denn die Therapie statt?
Ich habe hier in der Klinik auf der gynäkologischen Station einen Praxisraum, in dem ich vier Tage in der Woche Patienten empfange. Mit welchen Anliegen kommen die Patienten zu Ihnen? Ich spreche jetzt mal nur von den Brustkrebspatientinnen: Viele von Ihnen möchten in erster Linie Informationen haben. Sie wollen so viel wissen, wie möglich. Und ich habe die Zeit dafür. Mir darf man Fragen auch fünf Mal stellen. Das Gehirn ist so voll, da vergisst man schnell Dinge. Natürlich erfahren sie auch von den Ärzten alle wich-tigen Sachen. Aber ich spreche auch eine andere Sprache. Und für die Patienten ist es beruhigend, wenn sie die gleichen Dinge von verschiedenen Leuten hören.
Welche Informationen sind es, die Sie den Patienten geben? Haben Sie Beispiele?
Ja. Das sind Fragen zum Krankheitsverlauf. Die meisten haben Angst davor, was kommt. Aber auch davor, wie die Familie die Krankheit verkraftet oder ob sie ihren Job behalten können. Es ist auch immer davon abhängig, wo die Patienten stehen; brauchen sie eine Chemo, oder nur Tabletten oder Bestrahlung. Je nach Behandlung kann ich ihnen auch naturheilkundliche Mittel empfehlen, die unterstützend wirken.
Was ist ihre weitere Aufgabe nach der Information?
Das ist eindeutig die Krisenintervention, die Stabilisierung. Krebspatienten sind voller Ängste. Bei mir lernen sie, runterzukommen von der Angst und ihre Handlungs- und Denkfähigkeit wiederzuerlangen. Es gibt bestimmte Beruhigungs-Techniken. Manchmal reicht auch Aufklärung. Denn die Angst malt uns oft aus, was nicht die Realität ist. Angst ist kein guter Ratgeber. Außerdem ist es für viele Patienten ein gutes Gefühl, an einem neutralen Ort und mit jemandem, der nicht zur Familie oder zum Freundeskreis gehört, alles loszuwerden, Tacheles reden zu können.
Wie sieht so eine Intervention aus? Wie bekommen Sie die Patienten aus der Angststarre?
Angst lähmt uns. Das Gehirn ist auf „Achtung“ und „Gefahr“ programmiert. Da bleibt nicht viel Raum für Handlungsfähigkeit. Also versuche ich mit Techniken, das Gehirn aus dieser Angststarre zu befreien. Das funktioniert gut über gespeicherte Bilder und Emotionen, die ich mit dem „Wohlfühl-ABC“ hervorholen kann. Beispielsweise bitte ich den Patienten, mir fünf Begriffe mit A zu nennen, die gut für ihn sind. Der Suchmodus kostet Energie, das Gehirn ist von der Angst abgelenkt, der Körper entspannt sich. Der zweite Effekt ist, dass man an etwas denkt, das man mag. Da kann man nicht gleichzeitig Angst haben. Man wird ruhiger und kommt bei sich an.
Wie können Sie die Patienten konkret während der Chemotherapie unterstützen?
Da geht es vor allem um die Akzeptanz der Nebenwirkungen. Es ist normal, sich in dieser Zeit schlecht zu fühlen und nicht mehr so sein und handeln zu können wie sonst. Man ist nicht mehr so leistungsfähig. Die Patienten müssen akzeptieren, dass das jetzt normal ist. Man darf sich auch mal hinlegen oder Schmerztabletten nehmen. Persönlichkeitssätze wie zum Beispiel „Ich muss stark sein“ oder „Ich nehme nie Tabletten“ müssen ein stückweit geändert werden in dieser Ausnahmezeit. Außerdem kann ich auch hier handfeste Tipps für homöopathische oder anthroposophische Mittel geben, die während oder nach der Chemo hilfreich sind.
Wie viel nehmen sie von ihrer Arbeit mit nach Hause?
Ich mache natürlich Supervision, ohne geht es nicht. Dort kann ich alles abladen. Es gibt immer Fälle, die einem wesentlich näher gehen als andere. Ich sorge auch für mich und mache Dinge, die mir gut tun. Ich bewundere die Menschen, die mit einer Krebserkrankung umgehen. Sie entwickeln Kraft, Stärke und auch Reife, sie sehen die Gefahr als Chance. Die Patienten darin zu unterstützen das mag ich an meiner Arbeit.