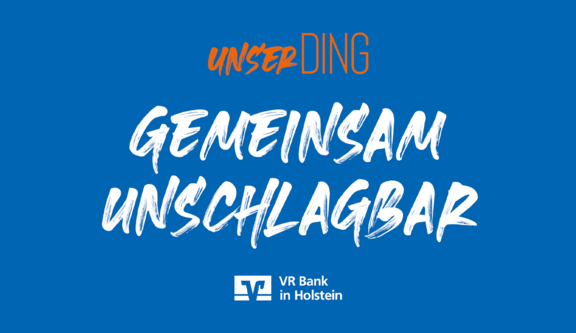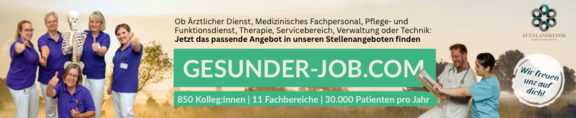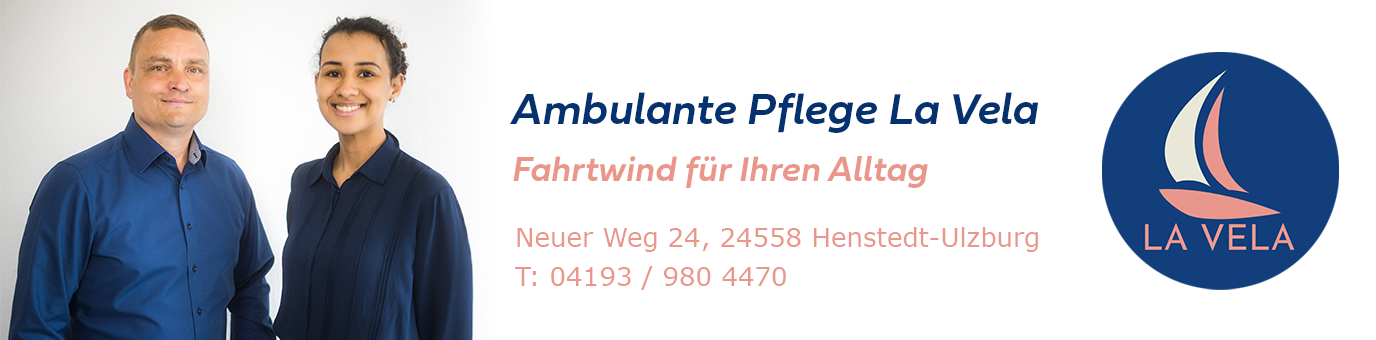Neumünster (em) In der kalten Jahreszeit treten gehäuft sogenannte „Grippe“-Erkrankungen auf, die durch Virusinfektionen ausgelöst werden. Gegen einige dieser Viren ist eine aktive Schutzimpfung möglich.
Es sei jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die angebotene Impfung keinen vollständigen Schutz vor einer Grippeerkrankung darstellt. Dies ist vor allem in der Tatsache begründet, dass ständig neue Virusstämme entstehen und bei der Entwicklung des jeweils aktuellen Impfstoffes nur eine gewisse Anzahl bereits bekannter Virusstämme berücksichtigt werden kann.
Impfstoff
Der verwendete Impfstoff enthält Bestandteile abgetöteter Grippeviren sowie verschiedene Trägerstoffe und Konservierungsmittel, welche im Einzelfall (z.B. bei bekannten Allergien) entsprechend dem jeweils verwendeten Impfstoff erfragt werden können. Der Impfstoff wird gespritzt. Vorzugsweise sollte diese Injektion in die Oberarmmuskulatur erfolgen.
Wer sollte geimpft werden?
Die Grippeschutzimpfung wird ausdrücklich empfohlen für Menschen, die älter als 60 Jahre sind sowie für Personen mit einer erhöhten gesundheitlichen Gefährdung infolge eines Grundleidens (z.B. chronische Lungen-, Herz-Kreislauf-, Leber- und Nierenkrankheiten, Zuckerkrankheit und andere Stoffwechselkrankheiten, Immunschwäche, HIV-Infektion). Des weiteren wird die Schutzimpfung auch für gesunde Personen empfohlen, bei denen ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Hierzu zählen z.B. Menschen, die in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr tätig sind und jene, die in medizinischen Bereichen arbeiten.
Wann sollte geimpft werden?
Die Grippeschutzimpfung sollte jährlich jeweils zu Beginn der kalten Jahreszeit ( in Deutschland September bis November) erfolgen. Zeitabstände zu anderen Impfungen sind nicht erforderlich.
Wer soll nicht geimpft werden?
Wie andere Impfungen auch, sollte die Grippeschutzimpfung nicht während einer akuten Erkrankung erfolgen. Frühestens sollte 2 Wochen nach erfolgter Genesung geimpft werden. Auch bei Personen, die Kontakt mit fieberhaft Erkrankten hatten, ohne dass die Erkrankung bisher ausgebrochen ist, sollte die Impfung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Auf keinen Fall dürfen Personen geimpft werden, bei denen Allergien gegen einen oder mehrere Bestandteile des Impfstoffes bekannt sind, z.B. gegen Thiomersal, Formaldehyd, Neomycin, Benzoesäure und Hühnereiweiß. Nach den bisherigen Erfahrungen mit Influenza-Impfstoffen sind keine Schäden bei der Anwendung in der Schwangerschaft zu erwarten, es liegen jedoch keine gezielten diesbezüglichen klinischen Studien vor. Daher sollte bei Schwangeren die Indikation zur Impfung sorgfältig geprüft werden.
Mögliche Reaktionen nach der Impfung
Als Ausdruck der normalen Auseinandersetzung des Organismus mit dem Impfstoff kann es gelegentlich innerhalb von 1-3 Tagen an der Impfstelle zu leichten Schmerzen, Rötung und Schwellung kommen, gelegentlich auch zu Verhärtungen oder Schwellung der zugehörigen Lymphknoten. Ebenfalls kann es nach der Impfung zu Allgemeinsymptomen wie Fieber, Frösteln, Übelkeit, Unwohlsein, Müdigkeit, Schwitzen, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen kommen. Die letztgenannten Allgemeinreaktionen dürften der Grund dafür sein, dass die Influenza-Impfung fälschlicherweise für das Auftreten Influenza-ähnlicher Erkrankungen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung verantwortlich gemacht wird. In der Regel sind diese genannten Lokal- und Allgemeinreaktionen vorübergehender Natur und klingen rasch und folgenlos wieder ab.
Komplikationen
Sehr selten werden allergische Reaktionen an Haut und Bronchialsystem beobachtet; über allergische Sofortreaktionen (anaphylaktischer Schock) wurde nur in Einzelfällen berichtet. Eine Allergie gegen Hühnereiweiß ist eine Gegenanzeige gegen die Impfung, da der Impfstoff in Hühnerembryonen produziert wird. Ebenfalls sehr selten kann es zu einer Vaskulitis oder einer vorübergehenden Thrombozytopenie kommen (Verminderung der für die Gerinnungsfunktion des Blutes bedeutsamen Blutplättchenzahl), als deren Folge Blutungen auftreten können. Im Zusammenhang mit einer Massenimpfung von US-Bürgern gegen die sogenannte „Schweinegrippe“ im Jahr 1976 trat das Guillain-Barré-Syndrom gehäuft auf. In der Folgezeit wurde das Guillain-Barré-Syndrom nur noch in Einzelfällen nach einer Influenza-Schutzimpfung beobachtet.