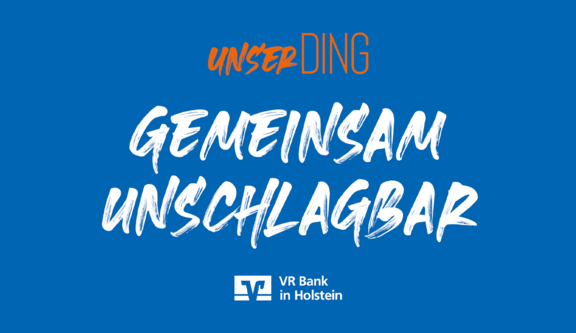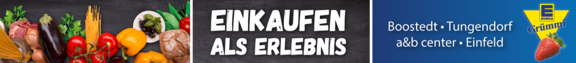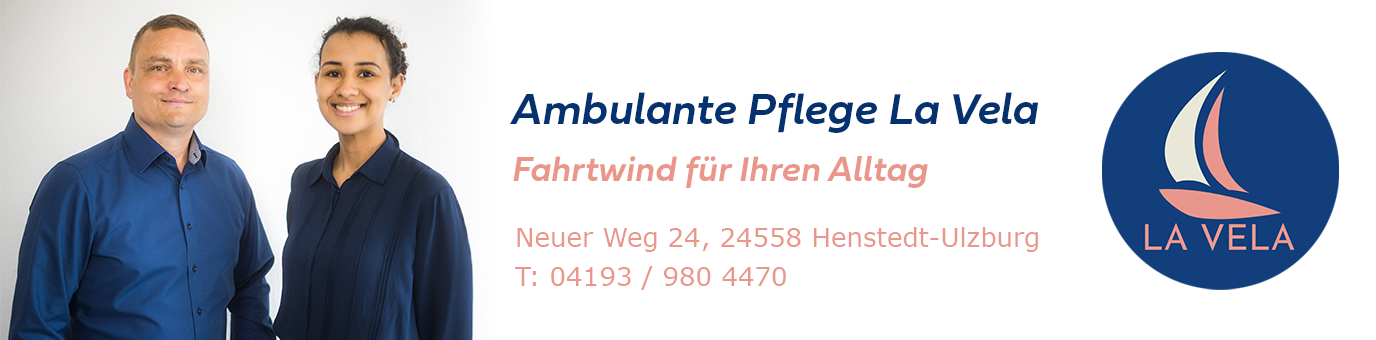Norderstedt (em) Der A erscheint zu einem Besprechungstermin bei seinem Rechtsanwalt und erzählt folgende Geschichte:
Er habe bis vor zwei Wochen in nichtehelicher Lebensgemeinschaft zusammengelebt. Die Beziehung habe über 10 Jahre gedauert. Vor acht Jahren habe die F von ihrer Großmutter ein Grundstück geerbt. Daraufhin habe man zusammen ein Haus gebaut. Der Hausbau sei nur möglich gewesen, weil er als gelernter Maurer viel habe selbst machen können. Darüber hinaus habe er Beziehungen zu diversen Baustoffhandlungen und seinerseits hatte er etwas Eigenkapital, da er von einer Tante 100.000 Euro geerbt hatte. Mit diesen 100.000 Euro habe er im wesentlichen die benötigten Materialien zusammengekauft.
Während der eigentlichen Bauzeit habe er sich ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub geben lassen und habe die Arbeiten im wesentlichen selbst gemacht. Geholfen hätten ihm dann noch Kollegen, die er organisieren konnte. Man sei ein größerer Freundeskreis unter Handwerkern und habe sich gegenseitig bei den jeweiligen Hausbauten geholfen, so wie das am Bau eben so üblich sei. So habe man ein komplettes Haus erstellen können und musste lediglich ein kleines Darlehen von 50.000 Euro aufnehmen, welches man dann in den folgenden Jahren mit gemeinschaftlicher Tilgung zu gleichen Teilen zurückgezahlt habe.
Auf die Frage des Rechtsanwalts nach der Bezifferung seiner genauen Beiträge fasst A zusammen, dass er wie gesagt seine 100.000 Euro Eigenkapital in das Objekt gesteckt habe und darüber hinaus seine Eigenleistung sicherlich noch mal so um die 50.000 Euro Wert gewesen sei. Alles zusammengerechnet habe das Objekt einen Wert von um die 200.000 Euro. Das Grundstück sei da nicht mitgerechnet. Der Rechtsanwalt fragt den A, was man denn damals besprochen habe, ob er beispielsweise Miteigentümer werden sollte, ob die 100.000 Euro als Darlehen gewährt werden sollten oder ob es sich um eine Schenkung an die F handelte.
Der A entgegnet, so genau habe man sich darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Man war halt verliebt und hatte große Pläne. Eigentlich wollte man sogar heiraten, aber dann kam plötzlich die Sache mit dem Grundstück und dem Hausbau dazwischen, so dass man erst einmal andere Sorgen hatte. Danach habe man noch einige Jahre glücklich in dem Objekt gewohnt, aber so vor fünf Jahren hätte es schon angefangen zu kriseln, so dass man spätestens zu diesem Zeitpunkt nicht mehr über Eheschließung oder dergleichen gesprochen habe. Auf nochmalige Nachfrage des Rechtsanwalts erklärt der A dann, dass man damals bei dem Bau des Objektes die Vorstellung hatte, sich ein gemeinsames Zuhause für die Zukunft zu schaffen.
Nunmehr habe er den Salat. Jetzt wohne er wieder in einer Mietwohnung, die F habe ihm gesagt, sie sei Eigentümerin des Hauses und er müsse ausziehen, da man sich ja getrennt habe. A erklärt, dass er das ungerecht finde und wenigstens sein, in das Objekt gesteckte, Kapital zurückhaben wolle. Der Rechtsanwalt berät den A - zutreffend - wie folgt: Ein Anspruch aus Darlehensvertrag scheide aus, da man sich damals bei der Zahlung des Geldes entsprechend hätte einigen müssen, dass ein Darlehen gewährt wird.
Teilweise werde versucht, derartige Probleme durch die Konstruktion einer sogenannten BGB-Gesellschaft zu lösen. Dazu müsste es aber eine Einigung zwischen den Parteien gegeben haben, das Haus praktisch als gemeinsames Projekt zu bauen. Ob sich ein solcher Wille hier nachweisen ließe, sei eher zweifelhaft. Immerhin habe sich aber inzwischen die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes geändert zu der Frage, wann Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft Ausgleichsansprüche untereinander haben.
Während früher seitens des Bundesgerichtshofes die nichteheliche Lebensgemeinschaft praktisch als „wirtschaften in einen Topf“ gesehen wurde, hat der Bundesgerichtshof mittlerweile seine Rechtsprechung differenziert. Grundsätzlich bleibt es dabei, dass die Lebensgemeinschaft eine wirtschaftliche Einheit ist und im Nachhinein einer vom anderen Partner keinen Ausgleich für in die Gemeinschaft gegebene Leistungen verlangen könne.
Dieses gelte aber nicht bei über den Alltag hinausgehenden wirklich überdurchschnittlichen Zuwendungen, die in Erwartung des Fortbestehens der Lebensgemeinschaft getätigt werden. Im Grunde genommen handele es sich insoweit um eine wertende Rechtsprechung zur Vermeidung grob ungerechter Ergebnisse. Der Nachteil liege wiederum darin, dass diverse wertende Elemente in diese Rechtsprechung einfließen. So müsse sich der A beispielsweise auch einen Nutzungsvorteil anrechnen lassen, da er über Jahre hinweg in dem Haus mitgelebt habe.
Aus diesem Grunde sei eine sichere Prognose hinsichtlich des Ausganges eines Rechtsstreits in diesem Fall keineswegs möglich. In taktischer Hinsicht helfe nur, einen möglichst hohen Anspruch anhängig zu machen, um Verhandlungsmasse mit der Gegenseite zu schaffen. Der Rechtsanwalt schlägt deshalb vor, die von A veranschlagte Leistung sowohl hinsichtlich Eigenkapital als auch eingebrachter Arbeitsleistung, also rundgerechnet 150.000 Euro, bei der F geltend zu machen. Ziel sei, einen Kompromiss zu erzielen und möglichst viel von der Forderung durchzusetzen.
Daraufhin fragt A nach dem finanziellen Risiko, welches er mit einem solchen Prozess eingehen würde. Der Rechtsanwalt erklärt nach einer überschlägigen Berechnung, dass er mit über 13.000 Euro rechnen müsse, wenn er schlimmstenfalls den ganzen Rechtsstreit verlieren würde. Der A wird nachdenklich und erklärt, er habe neulich etwas von einer Prozessfinanzierung gehört. Was habe es damit auf sich?
Die Prozessfinanzierung
Die Gesellschaft zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche, kurz GDzA, bietet Prozessfinanzierung an. Dabei übernimmt die GDzA das gesamte Prozessrisiko, vom ersten Vorschuss an den Rechtsanwalt bis zu den Kosten der Gegenseite, wenn der Rechtsstreit verloren gehen sollte. Das wirtschaftliche Risiko eines Prozesses beträgt daher für den Mandanten Null.
Im Gegenzug erhält die GdZA einen Anteil von dem Erlös, der nach Abzug der Kosten erzielt wird. Dabei legt die GDzA Wert auf eine kundenfreundliche und unbürokratische Abwicklung. Eine Anfrage muss nicht über einen Rechtsanwalt erfolgen und setzt schon erst recht keinen vollständigen Klagentwurf voraus. Und selbstverständlich kann ein Rechtsanwalt, der schon für den Mandanten tätig ist, die Sache weiter betreuen. „Bevor man also Ansprüche einfach verfallen lässt, weil man das Risiko der Durchsetzung scheut, sollte man uns unbedingt ansprechen“, rät Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Sohst, Gesellschafter der GDzA.
Rufen sie kostenlos an:
08 00 - 859 85 98
www.Prozess-ohne-Geld.de